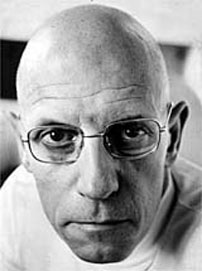
Schöne, zum Teil biographische Texte zur Erinnerung an Paule:
Es kommt nicht darauf an, ob man für oder gegen Michel Foucault ist. Es kommt darauf an, was man aus ihm macht.
Stefan Broniowski: Damit es nützt
Michel Foucault glänzte als Denker und Provokateur, als undogmatischer Linker und Gegenspieler Sartres. Er verstand es, sich erfolgreich einer disziplinierten Wissenschaft zu entziehen: Die Philosophie nannte ihn einen Historiker, Historiker sahen in ihm den Philosophen; Marxisten warfen ihm "infantile leftism" vor, weil er, wie er selbst mutmaßte, sich weigerte, die obligatorischen Marx-Zitate in seine Schriften einzuflechten.
Thomas Barth: Das Netz der Macht
1. Halbzeit
- Wenn das Spiel nicht läuft, dann muss mal auch mal agressiver in die Zweikämpfe gehen 16. min
- jetzt bloß nicht erschrecken lassen 31. min
- Kevin allein im Strafraum 43. min
- außer Ballack ist wenig los
- es macht mich schon seit Jahren krank!
- nur so kann man sich langsam wieder berauschen 52. min
- mit dem Schoß gestoppt ?. min
- das wars für die Europameisterschaft 92. min
Heute fand im Uni-Hauptgebäude die Senatsitzung der JLU statt. Der Senat hatte die Prominenz im Wissenschaftssektor eingeladen: Wissenschaftsminister Udo Corts.
Dieser ließ es sich nicht nehmen, mittels routinierter und arroganter Rhetorik immer wieder zu betonen, in welcher finanziell desolaten Lage sich Hessen befindet. „Wir liegen wirtschaftlich am Boden“. Das glaub ich kaum.
Mit viele Zahlen und Statistiken gelang es ihm, die Diskussion auf einem oberflächlichen Niveau zu halten. Konkretisierten sich dann Fragen des Senats bezüglich der folgenschweren Mittelkürzungen, meinte Corts stets, „darüber müsse man sich noch mal unterhalten.“ Warum war der gute Mann denn bitte da?
Mit zunehmender Resignation verfolgte ich, wie (nach einem guten Redebeitrag aus dem Plenum, der durch den Applaus des Publikums gewürdigt wurde) Herr Corts sich wünschte „auch lieber populistische Forderungen zu stellen, um Applaus zu bekommen.“ Er könne „auch ohne Applaus leben“. Kann ich mir gut vorstellen, ganz ehrlich.
Als Corts anfing, das von der hessischen Landesregierung eingeführte, Studienguthabensgesetz zu loben, dachte ich daran, dass in Foucaults Machtanalytikstarre Machtpositionen vielleicht ein wenig zu kurz kommen. (oder ist Corts bzw, dessen Position eine Herrschaftsposition?) Die Position des Wissenschadftsminister, in personifizierte Form: Corts, hatte in dieser Sitzung die eindeutige Definitionsmacht. Kritischen Fragen konnte er sich aufgrund seiner Position entziehen, er würde nicht in die Situation kommen, dass sein eigenes politisches Verhalten und das der Landesregierung legitimieren zu müssen.
Seine Position begründete er allerdings mit der demokratischen Wahl, die eindeutig auf seine Partei fiel. Ergo: selber schuld!
Na vielen Dank auch.
Dieser ließ es sich nicht nehmen, mittels routinierter und arroganter Rhetorik immer wieder zu betonen, in welcher finanziell desolaten Lage sich Hessen befindet. „Wir liegen wirtschaftlich am Boden“. Das glaub ich kaum.
Mit viele Zahlen und Statistiken gelang es ihm, die Diskussion auf einem oberflächlichen Niveau zu halten. Konkretisierten sich dann Fragen des Senats bezüglich der folgenschweren Mittelkürzungen, meinte Corts stets, „darüber müsse man sich noch mal unterhalten.“ Warum war der gute Mann denn bitte da?
Mit zunehmender Resignation verfolgte ich, wie (nach einem guten Redebeitrag aus dem Plenum, der durch den Applaus des Publikums gewürdigt wurde) Herr Corts sich wünschte „auch lieber populistische Forderungen zu stellen, um Applaus zu bekommen.“ Er könne „auch ohne Applaus leben“. Kann ich mir gut vorstellen, ganz ehrlich.
Als Corts anfing, das von der hessischen Landesregierung eingeführte, Studienguthabensgesetz zu loben, dachte ich daran, dass in Foucaults Machtanalytik
Seine Position begründete er allerdings mit der demokratischen Wahl, die eindeutig auf seine Partei fiel. Ergo: selber schuld!
Na vielen Dank auch.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
der Disziplin, des Selbsts und der Macht schreibt der Philosoph und Gesellschaftswissenschaftler Heinz Steinert im links netz.
Was uns als Flexibilisierung angetragen wird, ist tatsächlich ein enormer Schub an Normierung und Standardisierung unter dem verschärften Druck von Konkurrenz und den zugehörigen Ängsten, die bewältigt werden, indem wir andere in der Hoffnung ausschließen (lassen), dass wir dadurch selbst diesem Schicksal entgehen. Wir müssen uns zusätzlich die Normierung selbst antun und unsere Standardisierung selbst managen – nicht ohne Beratung, versteht sich, von der wir umstellt sind und von der wir gewöhnlich die Normen erst vermittelt bekommen, denen wir mit ihrer Hilfe gerecht werden sollen.
Der „zuverlässige Mensch der Wissensgesellschaft“ hat sich weit von der Unternehmer- und der Arbeiter-Disziplin der industriellen Produktion, von dem entfernt, was ursprünglich „Disziplin“ hieß. Er ist zuverlässig höchstens sich selbst gegenüber in seiner Bereitschaft, sich mit allen Wechselfällen des Lebens zu arrangieren (und die jeweils passende Beratung zu nutzen), in seinem unverdrossenen Willen, alle verlangten Rollen zu spielen und hohe Virtuosität dafür aufzubringen, die Widersprüche auszuhalten und seine eigene „Balance“ zwischen ihnen geschickt zu managen. Seine Zuverlässigkeit ist eine Selbstdisziplin zweiter oder dritter Ordnung.
H. Steinert: Neue Flexibilität, neue Normierungen:
Der zuverlässige Mensch der Wissensgesellschaft
Ein, wie ich finde, gelungener und kritischer Artikel über die Entwicklung der Selbstdisziplin, von deren instutionalisierten Beginn in Klöstern, bis hin zur Transformation zum neoliberalen Selbstmanagement.
Was uns als Flexibilisierung angetragen wird, ist tatsächlich ein enormer Schub an Normierung und Standardisierung unter dem verschärften Druck von Konkurrenz und den zugehörigen Ängsten, die bewältigt werden, indem wir andere in der Hoffnung ausschließen (lassen), dass wir dadurch selbst diesem Schicksal entgehen. Wir müssen uns zusätzlich die Normierung selbst antun und unsere Standardisierung selbst managen – nicht ohne Beratung, versteht sich, von der wir umstellt sind und von der wir gewöhnlich die Normen erst vermittelt bekommen, denen wir mit ihrer Hilfe gerecht werden sollen.
Der „zuverlässige Mensch der Wissensgesellschaft“ hat sich weit von der Unternehmer- und der Arbeiter-Disziplin der industriellen Produktion, von dem entfernt, was ursprünglich „Disziplin“ hieß. Er ist zuverlässig höchstens sich selbst gegenüber in seiner Bereitschaft, sich mit allen Wechselfällen des Lebens zu arrangieren (und die jeweils passende Beratung zu nutzen), in seinem unverdrossenen Willen, alle verlangten Rollen zu spielen und hohe Virtuosität dafür aufzubringen, die Widersprüche auszuhalten und seine eigene „Balance“ zwischen ihnen geschickt zu managen. Seine Zuverlässigkeit ist eine Selbstdisziplin zweiter oder dritter Ordnung.
H. Steinert: Neue Flexibilität, neue Normierungen:
Der zuverlässige Mensch der Wissensgesellschaft
Ein, wie ich finde, gelungener und kritischer Artikel über die Entwicklung der Selbstdisziplin, von deren instutionalisierten Beginn in Klöstern, bis hin zur Transformation zum neoliberalen Selbstmanagement.
Lia - am 18. Juni 2004, 17:45 - Rubrik: ahh, se tre scholie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Bildungsbegriff - Was ist das? Sich diese Frage in der Abschlussphase des Pädagogikstudiums zu stellen, und sich dessen auch völlig bewusst zu sein, hinterlässt ein flaues Gefühl im Magen. Da ich flaue Gefühle in Bäuchen nur unter besonderen Umständen tollerieren kann, musste ich mich damit auseinandersetzten. Hier also meine Gedanken und Interpretation:
Der Begriff Bildung wurde im 19. Jahrhundert eng mit dem der Kultur verknüpft. Das Wechselverhältnis zwischen Selbst und Welt stand im Mittelpunkt, da davon ausgegangen wurde, dass Bildung die Individuen dazu befähigt, Kultur aktiv mitzugestalten. Das Individuum wurde in der idealistischen Vorstellung von Bildung zu vernünftiger Selbstbestimmung befähigt. Bildung verstand sich in erster Linie als Selbstbildung, als reflexiven Prozess auf dem Weg zur eigenen Individualität.
Allen Individuen sollte der Zugang zu Bildung ermöglicht werden, so der egalisierende Gedanke, der sich gegen eine nach Nützlichkeit orientierende Ausrichtung der Bildung auf den Beruf stellte. Dafür wurde der Begriff der Ausbildung gebraucht.
In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde dieser idealistische Bildungsbegriff zunehmend kritisiert, da er als überhöht und unzeitgemäß betrachtet wurde.
Die Neuorientierungsversuche basierten auf der Annahme, dass Bildung nötig ist, damit sich Menschen immer wieder neues Wissen aneignen können, um in sich ständig verändernden Situationen agieren zu können.
Der Bildungsbegriff zielt somit immer stärker auf Anpassungsleistungen ab und richtet nach den Bedarfen des (Arbeits)marktet aus.
Der Erwerb von „soft skills“ und Schlüsselkompetenzen verweist auf diese Tendenz, da es immer wichtiger wird sich flexibel auf die Anforderungen der Marktordnung einstellen zu können.
Diese Tendenz lässt sich kaum verleugnen. Die Verschiebung der Begriffsbedeutung impliziert weitreichende gesellschaftliche Veränderungen. Das erwünschte Bild des Menschen im 21. Jahrhunderts zeigt das eines aktiven, funktionierenden, flexiblen, risikobereiten, selbstverantwortlichen Subjekts, dass vor lauter Schlüsselkompetenzen kaum mehr in der Lage ist, zu reflektieren oder zu denken.
Damit will ich nicht sagen, dass dies bereits so sei, allerdings sehe ich die Allgegenwärtigkeit dieser Entwicklung. So haben manche Bachelor bzw. Master Studiengänge nur noch wenig mit dem Gedanken der Universität nach Humboldt zu tun.
Mag sein, dass der idealistische Bildungsbegriff für die Gegenwart überholt erscheint, dennoch ist es vielleicht wichtig, nicht zu vergessen, dass Bildung mehr sein kann, als nur die Vorbereitung auf die "Praxis".
Der Begriff Bildung wurde im 19. Jahrhundert eng mit dem der Kultur verknüpft. Das Wechselverhältnis zwischen Selbst und Welt stand im Mittelpunkt, da davon ausgegangen wurde, dass Bildung die Individuen dazu befähigt, Kultur aktiv mitzugestalten. Das Individuum wurde in der idealistischen Vorstellung von Bildung zu vernünftiger Selbstbestimmung befähigt. Bildung verstand sich in erster Linie als Selbstbildung, als reflexiven Prozess auf dem Weg zur eigenen Individualität.
Allen Individuen sollte der Zugang zu Bildung ermöglicht werden, so der egalisierende Gedanke, der sich gegen eine nach Nützlichkeit orientierende Ausrichtung der Bildung auf den Beruf stellte. Dafür wurde der Begriff der Ausbildung gebraucht.
In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde dieser idealistische Bildungsbegriff zunehmend kritisiert, da er als überhöht und unzeitgemäß betrachtet wurde.
Die Neuorientierungsversuche basierten auf der Annahme, dass Bildung nötig ist, damit sich Menschen immer wieder neues Wissen aneignen können, um in sich ständig verändernden Situationen agieren zu können.
Der Bildungsbegriff zielt somit immer stärker auf Anpassungsleistungen ab und richtet nach den Bedarfen des (Arbeits)marktet aus.
Der Erwerb von „soft skills“ und Schlüsselkompetenzen verweist auf diese Tendenz, da es immer wichtiger wird sich flexibel auf die Anforderungen der Marktordnung einstellen zu können.
Diese Tendenz lässt sich kaum verleugnen. Die Verschiebung der Begriffsbedeutung impliziert weitreichende gesellschaftliche Veränderungen. Das erwünschte Bild des Menschen im 21. Jahrhunderts zeigt das eines aktiven, funktionierenden, flexiblen, risikobereiten, selbstverantwortlichen Subjekts, dass vor lauter Schlüsselkompetenzen kaum mehr in der Lage ist, zu reflektieren oder zu denken.
Damit will ich nicht sagen, dass dies bereits so sei, allerdings sehe ich die Allgegenwärtigkeit dieser Entwicklung. So haben manche Bachelor bzw. Master Studiengänge nur noch wenig mit dem Gedanken der Universität nach Humboldt zu tun.
Mag sein, dass der idealistische Bildungsbegriff für die Gegenwart überholt erscheint, dennoch ist es vielleicht wichtig, nicht zu vergessen, dass Bildung mehr sein kann, als nur die Vorbereitung auf die "Praxis".
Lia - am 16. Juni 2004, 22:26 - Rubrik: governing thoughts
Bei dem Typus, der zur Fetischisierung der Technik neigt, handelt es sich, schlicht gesagt, um Menschen, die nicht lieben können.
Theodor W. Adorno: Erziehung nach Auschwitz
Manchmal ging Adorno echt zu weit =)
Theodor W. Adorno: Erziehung nach Auschwitz
Manchmal ging Adorno echt zu weit =)
Lia - am 14. Juni 2004, 21:05 - Rubrik: ahh, se tre scholie

Lia - am 11. Juni 2004, 20:08 - Rubrik: Perspektiven
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Im Gegensatz zum technizistischen Begriff der Informationsgesellschaft eröffnet "Wissensgesellschaft" eine Perspektive, die auf den Willen und die Befähigung der Menschen zu Selbstbestimmung setzt.
Nicht Rechnerleistungen und Miniaturisierung werden die Qualität der künftigen gesellschaftlichen Entwicklung bestimmen. Entscheidend wird die Auswahl des Nützlichen und die Fähigkeit zum Aushalten von Ambivalenzen und Unsicherheit sein, die Gestaltung des Zugangs zu Wissen und der fehlerfreundliche Umgang mit dem Nichtwissen.
wissensgesellschaft.org
Sehr interessante Seite mit vielen Texten zum Thema.
Prädikat: empfehlenswert =)
Nicht Rechnerleistungen und Miniaturisierung werden die Qualität der künftigen gesellschaftlichen Entwicklung bestimmen. Entscheidend wird die Auswahl des Nützlichen und die Fähigkeit zum Aushalten von Ambivalenzen und Unsicherheit sein, die Gestaltung des Zugangs zu Wissen und der fehlerfreundliche Umgang mit dem Nichtwissen.
wissensgesellschaft.org
Sehr interessante Seite mit vielen Texten zum Thema.
Prädikat: empfehlenswert =)

Lia - am 7. Juni 2004, 15:05 - Rubrik: Perspektiven
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Instrument der modernen Gouvernementalität lässt sich als Community-Bildung identifizieren. Durch einen Netzwerkzusammenschluss mit verbindlichen regelmäßigen Treffen, Rundbriefen etc. wird eine Gemeinschaft konstruiert und explizit ein Vergleichsdruck zwischen den einzelnen Mitgliedern etabliert.
Dies wird jedoch nicht als bedrückend empfunden, sondern vielmehr als Supportstruktur: die führenden Einrichtungen sollen als „best-practise“ Beispiele dienen, an denen sich die schlechteren orientieren sollen. Innerhalb dieser communities wird ein Mindeststandart definiert, dessen Einhaltung Voraussetzung für die Teilhabe an der Community ist.
Nach Innen wird durch den Druck der Communities ein qualitätsförderndes Verhalten aufgebaut, während die communities nach Außen, also in Richtung Bildungspolitik, die Definition von Qualität im Weiterbildungsbereich mitbestimmen und mitregieren.
Macht das irgendwie Sinn?
Dies wird jedoch nicht als bedrückend empfunden, sondern vielmehr als Supportstruktur: die führenden Einrichtungen sollen als „best-practise“ Beispiele dienen, an denen sich die schlechteren orientieren sollen. Innerhalb dieser communities wird ein Mindeststandart definiert, dessen Einhaltung Voraussetzung für die Teilhabe an der Community ist.
Nach Innen wird durch den Druck der Communities ein qualitätsförderndes Verhalten aufgebaut, während die communities nach Außen, also in Richtung Bildungspolitik, die Definition von Qualität im Weiterbildungsbereich mitbestimmen und mitregieren.
Macht das irgendwie Sinn?
Lia - am 5. Juni 2004, 13:14 - Rubrik: governing thoughts
